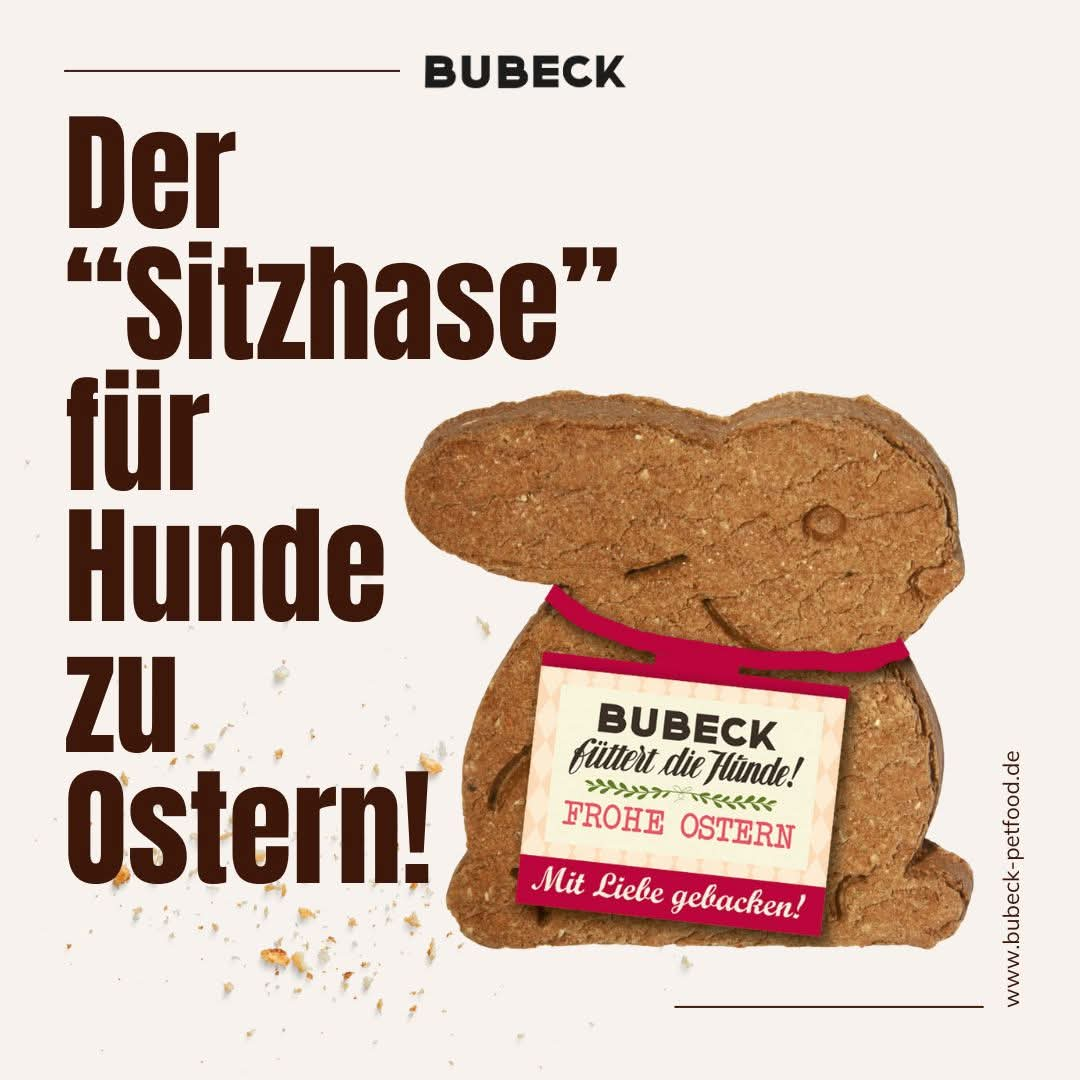Der Osterhase, die Empörten und das vergessene Wissen – eine kleine Abrechnung zum Frühlingsfeuer der Gefühle
Hier kannst du den Artikel teilen
Manchmal reicht ein Hase, um eine ganze Gesellschaft ins Hoppeln zu bringen. So geschehen, als Lidl es wagte, seine Schokoladenosterhasen "Sitzhase" oder "Stehhase" zu nennen. Der Aufschrei kam postwendend: "Cancel Culture!" – "Woke-Wahnsinn!" – "Unsere christliche Kultur wird abgeschafft!"
Dabei hat niemand den Osterhasen abgeschafft. Er sitzt nur da. Oder steht. Je nachdem, wie die Form gegossen wurde. Und wer schon mal versucht hat, einen Hasen aus Schokolade stehend zu gießen, weiß: Das ist statisch eine Meisterleistung.
Während also Teile der Nation ihren ärgerlichen Hasen galoppieren lassen, lohnt sich ein Blick hinter die Fassade der Empörung. Denn wer sich so lautstark um Tradition sorgt, sollte vielleicht erst einmal wissen, worum es bei diesen Traditionen eigentlich geht. Die Empörung ist laut, aber oft frei von Substanz. Eine Art Fast Food der Moral.
Was hat der Hase mit Ostern zu tun?
Kurz gesagt: nichts. Zumindest nichts mit dem biblischen Teil. Der Hase ist weder am Grab erschienen, noch hat er das Grab geöffnet oder Eier bemalt.
Die Wurzeln des Osterfests reichen tiefer, viel tiefer – in eine Zeit vor dem Christentum. Die Germanen feierten um die Frühlings-Tagundnachtgleiche herum ein Fest zu Ehren einer möglichen Fruchtbarkeitsgöttin namens Ostara. Ob sie historisch belegt ist? Wohl kaum. Der angelsächsische Gelehrte Beda erwähnt im 8. Jahrhundert einen Monat "Eosturmonath", dessen Name von einer solchen Göttin stammen könnte. Mehr gibt es nicht. Jakob Grimm griff diese Andeutung im 19. Jahrhundert auf und erweiterte sie mit erzählerischer Fantasie. Die Figur Ostara wurde zu einem Symbol für eine verlorene, naturverbundene Urreligion – ein Mythos über einen Mythos. Aber gerade das erklärt, warum sich das Bild vom "heidnischen Osterfest" so hartnäckig hält: weil es eine Lücke schließt, die wir spüren, aber nicht belegen können.
Warum bemalt man Eier?
Praktisch gedacht: In der Fastenzeit durfte man keine Eier essen. Die Hühner legten aber trotzdem fleißig weiter. Um die ältesten von den frischesten zu unterscheiden, wurden sie farblich markiert. Rot zuerst essen, Gelb später. Die Symbolik kam erst später drauf, so wie der Zuckerguss auf den Hefezopf.
Man kann also sagen: Die bemalten Ostereier waren kein Ausdruck fröhlicher Dekofreude, sondern ein haltbarkeitsbedingter Sortiermechanismus. Funktion über Form, ganz einfach.
Aber warum bringt der Hase die Eier?
Eine der schönsten Fragen, die kaum jemand stellt. Denn Hasen legen bekanntlich keine Eier. Da helfen auch keine Kinderbücher und Schokoladenverpackungen. Die Verbindung ist ein Relikt aus der Mythologie und Symbolik: Hase = Fruchtbarkeit. Ei = Fruchtbarkeit. Beide gemeinsam = Frühlingssymbol.
Historiker vermuten, dass im 17. Jahrhundert in protestantischen Gegenden der Brauch aufkam, Kindern zu erzählen, der Hase würde die Eier verstecken. Es war eine erzählte Fabel, ein Märchen, das sich mit dem zunehmenden Bürgertum verbreitete und vermarktete. Besonders in Zeiten, in denen man religiöse Bräuche kindgerecht und spielerisch machen wollte.
In anderen Regionen übrigens brachte nicht der Hase die Eier, sondern der Kuckuck, der Storch oder gar der Fuchs. Allesamt Tiere mit Frühlingsbezug und Symbolkraft. Der Hase hat sich halt einfacher verkauft.
Und was ist eigentlich mit den Ferien?
Auch so ein Thema, das in der Osterwelle gerne untergeht. Denn Ostern heißt für viele: Endlich Urlaub!
Was einst als Vorbereitung auf Aussaat und Ernte gedacht war, ist heute Anlass für Fernweh und Preisfrust. Dass die Sommerferien sechs Wochen dauern, hat seinen Ursprung nicht im Wunsch nach Sonnencreme und Pool, sondern im Getreidefeld. Man brauchte die Kinder zur Erntezeit auf dem Hof.
Osterferien? Klar: Aussaatzeit. Wer sollte sonst die Pflugspur begradigen? Herbstferien? Natürlich nur in den Regionen mit Weinbau, man brauchte kleine, flinke Hände für die Lese. Heute sagt man: "Bildungsurlaub", früher sagte man: "Wenn das Feld nicht bestellt ist, gibt's nichts zu essen." Und wer sich fragt, warum in Bayern besonders lange Ferien sind – tja, das Rind will eben nicht allein vom Himmel fallen.
Heute hingegen meldet man die Kinder lieber "krank", um vor Ferienbeginn einen Tag früher im Günstiger-Flieger zu sitzen. Die einst existenzielle Bedeutung der Ferien ist vergessen. Der Wert des Unterrichts ohnehin. Was zählt, ist der Instagram-Post vom Flughafen mit dem passenden Hashtag: #VerdienterUrlaub #endlichraus #sitzhaseaufreisen
Empörung, wohin das Auge reicht – aber bitte ohne Fakten.
Die lautesten Stimmen, die sich über einen "Sitzhasen" echauffieren, wissen oft nicht einmal, was Ostern eigentlich bedeutet. Dass es um Tod und Auferstehung geht. Dass der christliche Teil des Fests nichts mit Hasen, Eiern oder Geschenken zu tun hat. Dass die heidnischen Ursprünge des Fests älter, stärker und überraschend bodenständig sind.
Historisch betrachtet hat die Kirche selbst lange gebraucht, um das Osterfest zu "christianisieren". Das Konzil von Nicäa im Jahr 325 legte den Termin fest: Der Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühling. Ein klarer Kompromiss mit den heidnischen Kalenderzyklen, damit man die Leute nicht verlor.
Und wir?
Wir kaufen den Schokohasen, regen uns über seine Haltung auf und feiern ein Frühlingsfest, das keiner mehr versteht. Der Hase als Symbol? Alt. Das Ei? Noch älter. Der Mensch? Offenbar zunehmend vergesslich.
Vielleicht wäre es sinnvoller, sich weniger darüber aufzuregen, wie ein Schokohase heißt – und mehr darüber nachzudenken, was wir überhaupt feiern. Oder warum wir glauben, wir würden etwas verlieren, nur weil ein Discounter sein Produkt nicht mehr "Osterhase XL Deluxe" nennt.
Denn wenn die christliche Kultur wirklich an einem "Sitzhasen" scheitert, dann haben wir vielleicht ganz andere Probleme.
Vielleicht geht es ja nicht um Beweisbarkeit, sondern um Bedeutung.
Nicht jeder Mythos braucht eine Quelle. Nicht jede Tradition eine Urkunde. Was über Generationen weitererzählt wurde, in Familien weiterlebte, von Kindern geglaubt und von Alten liebevoll verklärt wurde, hat seinen Platz. Vielleicht keinen wissenschaftlichen, aber einen seelischen. Ob Fasching als Winteraustreibung, Weihnachten als Geburt des Lichtes oder Ostern als Wiedergeburt der Hoffnung – all diese Feste tragen ältere, tiefere Schichten in sich. Und manchmal, da lässt sich Geschichte nicht belegen, sondern nur empfinden.
Frohes Frühlingsfest. Und immer schön die Eier markieren.